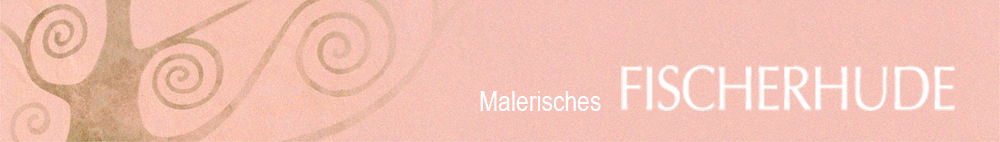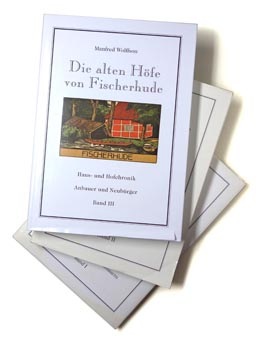unser Jubiläum Teil 2 (Text M.Wolffson)
unser Jubiläum Teil 2 (Text M.Wolffson)
Die Einwohner des Fleckens Fischerhude konnten der Zukunft beruhigt entgegensehen. Bis Ende des 12. Jahrhunderts lagen, zerstreut im Wümmedelta, 8-9 Siedlungen (Höfe), zwischen den Wümmearmen. Sie wurden nach Norden (in Richtung Quelkhorn) durch den sogenannten ,,Fleckensgraben“ geschützt. Nach Süden (in Richtung Sagehorn) sorgte der ,Mühlenstreek“ für die notwendige Sicherheit vor ungebetenen Eindringlingen. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts (1610), zählten die Beamten des Bremer Erzbischofs in Fischerhude nicht 18 Höfe wie noch 1535, sondern 34 Betriebe.
Das starke Bevölkerungswachstum im 16. Jahrhundert hatte „inne Hue“ (wie man unser Dorf kurz und knapp auf Plattdeutsch nennt) und auch andernorts – zur Abtrennung kleinerer Hofstellen von den schon bestehenden geführt. Die abgetrennten Stellen wurden von Bauernsöhnen bewohnt, die in der Erbfolge nicht berücksichtigt werden konnten. Da in Fischerhude immer der jüngste Sohn erbte, waren es folglich seine älteren Brüder, die auf diese Weise abgefunden wurden. Diese – nichterbenden – Söhne nannte man ,,Köthner“, worüber sie sicherlich nicht eben glücklich waren. Denn erstens konnten sie sich durch Abwanderung und Neuansiedlung nicht mehr verbessern, weil fast alle Nutzflächen der Umgebung schon vergeben waren. Und zweitens waren sie als Köthner gegenüber den Bauleuten in ihrer sozialen Stellung benachteiligt. Zwar mussten sie bei allen Kontributionen Abgaben und Diensten nur den halben Baumannsteil leisten, hatten dadurch aber auch nur die Hälfte aller Rechte, die den Bauleuten zufielen. Sie waren Bauern 2. Klasse.
Hinrich Schloen, Gründer des in Ortsmitte gelegenen Dorfmuseums „Heimathaus Irmintraut“, stellte es sich so vor: Am Wümmestreek und Fleckensgraben lagen 25 bis 30 langgestreckte, strohgedeckte Gebäude eng zusammengedrängt. Unter den moosbewachsenen Strohdächern schauten die zweizeiligen, weißgetünchten Lehmwände hervor. Aus der zum Wasser gekehrten “Groten Döör” und den quergeteilten „Blangndöörn“ quoll zu jenen Zeiten starker Rauch. Neuere Gebäude führten schon Glasfenster, hin und wieder sah man wohl auch schon Wandflächen mit roten Backsteinen ausgefüllt. Zwischen den Wohnhäusern drängten sich Scheunen, Wagenschauer und Backhäuser als Nebengebäude, die bei steigendem Wohnbedarf den Zweig- und Knechtsfamilien als Hausungen zugewiesen wurden. Einige dieser anfänglichen Notwohnungen bestehen bis auf den heutigen Tag als ausgebaute Häuser. Sie hatten damals noch kein Herdrecht, durften also kein Feuer entzünden. Zum Kochen und Wärmen stand ihren Bewohnern das Haus ihres Großbauern zur Verfügung.
Besonders zu empfehlen ist das aktuelle, farbige, 560-Seiten starke Werk von Manfred Wolffson, das rechtzeitig zur diesjährigen 900-Jahrfeier von Fischerhude fertiggestellt wurde.
Erworben werden können alle 3 Bände der Chronik im Dorf in „Brünings Scheune“, im „Otto-Modersohn-Museum“, bei „Körbers Gasthof“ oder beim Herausgeber unter Telefon-Nr. 04293-7641